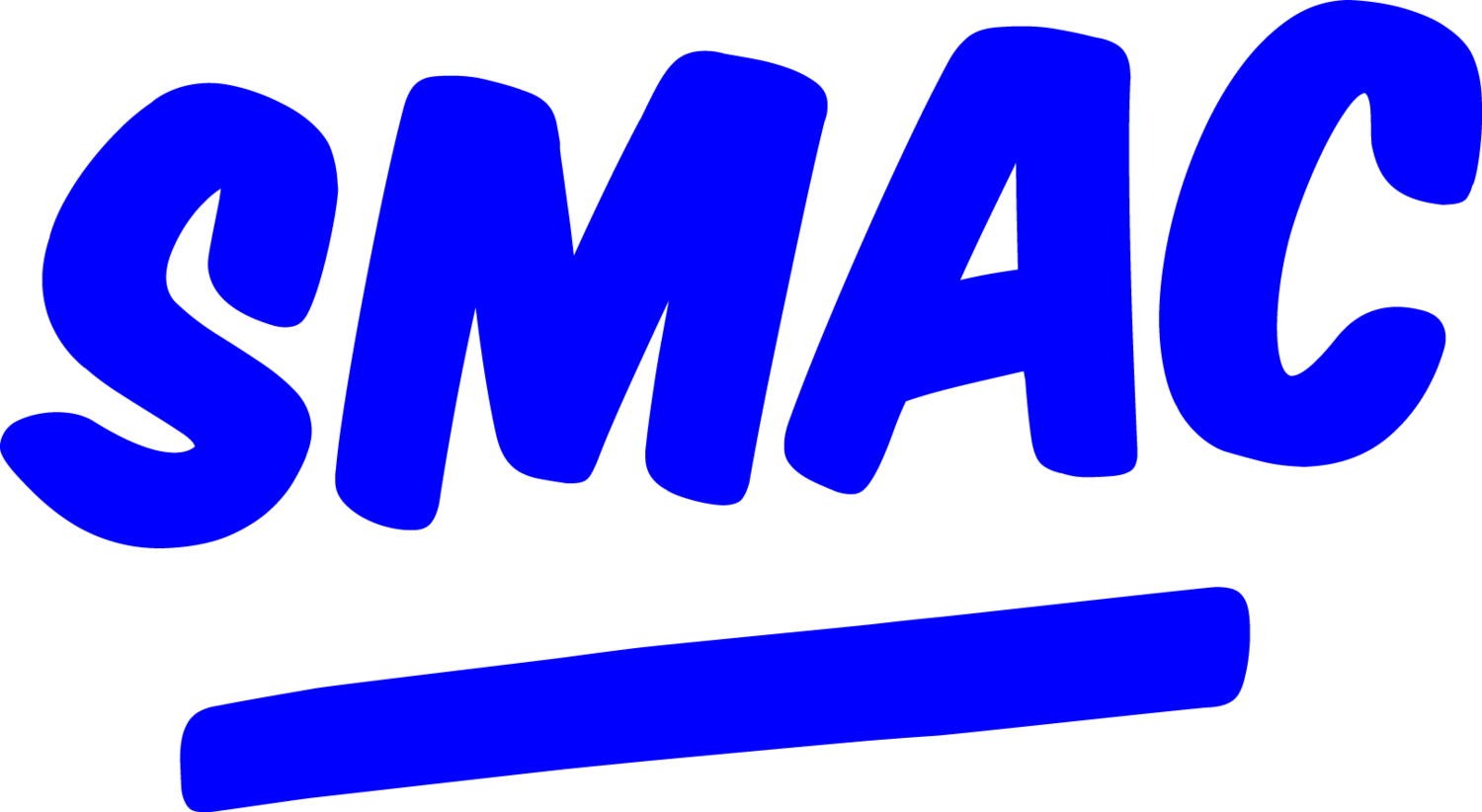Interview mit Clemens Krauss
Akteurinnen // 11. September – 16. Oktober 2020
Der österreichische Künstler Clemens Krauss bewegt sich in seinen Arbeiten zwischen der An- und Abwesenheit von Farbe und materieller Präsenz. Wir sehen geschichtete, extrem pastose Farbaufträge als Figuren, die aus der Leinwand zu springen scheinen. Oder unverwandte Skulpturen, die aus reiner Ölfarbe bestehen und geduldig in Schichten aufgetragenen worden sind. Wir sehen aber auch eine feingliedrige Malerei, die sich mit der Symbolhaftigkeit der Leere beschäftigt - welche lauter schallen kann als das sichtbar Anwesende.
Zahlreiche Auslandserfahrungen unter anderem in China, Brasilien oder Australien inspirierten Krauss in seinen Arbeiten, in denen er oft über komplexeste politische, soziale und kulturelle Strukturen reflektiert. Trotz ausfallender Reisen aufgrund der Coronapandemie schafft er in seinem Online-Performance-Projekt „Isolation Consultation“ eine neue Brücke zwischen persönlichem Kontakt und räumlicher Distanz.
Als bildender Künstler, aber auch ausgebildeter Psychoanalytiker, vereint der Künstler psychoanalytische Techniken und verarbeitet immer wiederkehrende Rückgriffe auf eigene und fremde Biografien. Über die Verflechtung von Vergangenem und Gegenwärtigen, die An- und Abwesenheit, das Motiv der Wiederholung und seine kommende Ausstellung im Projektraum SMAC sprachen wir mit Clemens Krauss im Interview.
SMAC: Deine Arbeit mit massiven, vielschichtigen Farbaufträgen ist bei Deinen neuen Werken „Akteurinnen“ von der Leinwand auf Skulpturen aus reiner Ölfarbe übergegangen. Wie entstand die Idee, Dein Oeuvre mit diesen dreidimensionalen Objekten zu erweitern?
Clemens Krauss: Die Farbe als Objekt an sich spielt in meiner Arbeit schon immer eine große Rolle. Sowohl in den malerischen Arbeiten, als auch beispielsweise in einer Serie, in der ich reine Körper aus Ölfarbe in Glasvitrinen sowohl in Position als auch in räumlicher Perspektive rekombiniert habe.
Die aktuellen Skulpturen aus purer Ölfarbe sind nun ein radikalerer Schritt und für mich eine logische Konsequenz. Die dreidimensionale Malerei verlässt quasi die Leinwand und bleibt dabei im Grunde noch Malerei.
Zu meinen Arbeiten, in denen ich typischerweise sehr viel Ölfarbe auf sonst flächig gehaltenen Leinwänden verwende, werde ich oft gefragt: ‚Ist das noch Malerei oder ist das schon Skulptur?‘ Diese Frage ist für mich jedoch irrelevant. Denn der Unterschied ist so ähnlich wie jener zwischen abstrakt und konkret. Da gibt es einen Übergangsbereich und in dem bewege ich mich.
Dich interessiert die Interaktion zwischen Deinen Skulpturen und den Betrachtenden. Sind wir als Betrachter die „Akteurinnen“ oder deine Arbeiten?
CK: Beides. Und es kommt sogar noch etwas Drittes hinzu: Nämlich dieser Moment der Interaktion an sich. Das, was die Betrachtenden und die Arbeiten – in meiner indirekten Abwesenheit - gemeinsam erschaffen. Es entsteht ein weiterer Wahrnehmungs- oder Erfahrungsraum. Das hat einerseits mit der materiellen Präsenz der Farbe als Körper zu tun, andererseits mit meiner eigenen performativ-partizipatorischen Grundhaltung. In vielen meiner Arbeiten geht es um Interaktion, Partizipation und den performativen Charakter des Prozesses.
Deine Ölfarbskulpturen bestehen aus vielen Schichten. Steht das Endergebnis von vornherein fest oder werden Schichten im Laufe der Zeit neu überdacht?
CK: Aufgrund der sehr langen Trocknungszeiten, die immer zwischen dem Anbringen von neuer Ölfarbe vergehen, und den damit verbundenen Veränderungen des Materials, ist dieser Prozess irgendwann nicht mehr steuerbar. Ich habe schon mal aus Farbpaletten die Farbreste abgekratzt und da kam ich auf kiloweise getrocknete Farbreste. Das ist ja wie sehr harter Kunststoff. Daraus habe ich die ersten Skulpturen aus reiner Farbe gebaut.
Die aktuell geometrischen Formen, die jetzt in der Ausstellung „Akteurinnen“ gezeigt werden, waren eine andere Herausforderung: Zunächst gab es Skizzen, in welche Richtung die Form in etwa gehen soll. Ab einem gewissen Zeitpunkt war es jedoch nicht mehr kontrollierbar. Da wurde es sozusagen malerisch. Hinzu kommt die organische Natur der Ölfarbe. Ich sehe das ja auch bei den großen Ölbildern: Die verändern sich im Laufe der Zeit. Jeder Restaurator kennt diese Veränderungsprozesse von Ölfarbe. Bei meinem massiven Einsatz des puren Materials entsteht jedoch besonders viel Gewicht, viel Spannung. Die Farbe schrumpft oder bricht auf. Es kann passieren, dass Öl austritt. Das sind aber keine destruktiven Prozesse, das sind einfach Prozesse, die eben jener organischen Natur der Ölfarbe entsprechen. Ölfarbe ist ja in der Regel für „flacheres“ oder allenfalls pastoses Alla-Prima-Malen gedacht, weniger dafür, dass man es in getrockneter Form wie ein Bildhauer wie ein Stück Holz, Stein oder ein anderes kompaktes Material behandelt.
Wenn man mit so viel Ölfarbe arbeitet, entsteht sicherlich auch ein sehr spezieller, starker Geruch. Spielt der Geruchssinn für Dich und Deine Arbeiten eine Rolle?
CK: Auf jeden Fall. Ich würde sogar sagen, dass es zu diesem Erleben dazu gehört. Neben dem räumlichen, dem visuellen und dem taktilen Moment gibt es eben die Dimension des Olfaktorischen. Leider hört die Ölfarbe irgendwann auf zu riechen. Bei dieser materiellen Präsenz kann es aber viele Jahre dauern. Um als Arbeit prinzipiell zu funktionieren, braucht es das aber auch nicht existenziell. Doch es ist ein schöner Moment und ich freue mich darauf im SMAC. Gerade am Anfang wird das bestimmt sehr präsent sein und im Raum oben, wo die Skulpturen gezeigt wurden, wird man das intensiv wahrnehmen können.
Im Gegensatz zu der starken Präsenz von Material und Farbe in z.B. „Akteurinnen“, steht die feingliedrige Arbeit Remaining Silent. Die Arbeiten vermitteln eine schmerzhafte Leere. Was zieht Dich an der Geschichte hinter den gezeigten Hohlräumen an?
CK: Das Gegensatzpaar An- und Abwesenheit, was ja zusammengehört! In der Arbeit Remaining Silent geht es ganz explizit um die Sprengung der historischen Buddha-Statuen und Weltkulturerbeikonen in Bamiyan im Jahr 2001 durch religiöse Fanatiker. Im Sinne des Ikonoklasmus, ein Symbol zerstören zu wollen: Hier wird deutlich, dass diese Auslöschung zum Scheitern verurteilt ist. Weil diese Leere in den verbliebenen Nischen noch schreiender ist. Dieses Schweigen ist unheimlich aussagekräftig, vielleicht sogar stärker als das Symbol, das zerstört wurde. Der Versuch, etwas auszulöschen - eine Erinnerung oder ein Bild - kann oft viel stärkere Bilder hervorrufen. Deswegen heißt die Arbeit auch Remaning Silent - still bleiben, schweigen. Schweigen kann manchmal sehr brutal sein.
Du hast gesagt, dass du dich schon im jungen Alter für die Kunst interessiert hast. Gab es jemanden, der diese Leidenschaft in die geweckt hat?
CK: Ich hatte am Gymnasium eine sehr tolle Lehrerin, die im Gegensatz zu vielen anderen nicht nur in der Renaissance oder antiken Kunstvermittlung tätig war. Wir haben uns sehr viel zeitgenössische Kunst angeschaut und uns damit auseinandergesetzt. Da hat sie uns Schülerinnen und Schülern ganz schön was zugemutet. Im Rückblick finde ich das richtig. Oftmals hört in dieser klassischen gymnasialen Ausbildung die Kunst irgendwann mit der klassischen Moderne auf. Sich mit der Gegenwartskunst zu beschäftigen, ist wahrscheinlich für viele Lehrer überfordernder als für die Schüler.
In Deiner Videoarbeit Lieber Clemens / Dear Clemens findet ein Dialog zwischen eben diesem jugendlichen, etwa 13jährigem Clemens und dem Clemens im Hier und Jetzt statt. Was hat sich verändert?
CK: Schau mich an (lacht). Zunächst mal ist es erstaunlich, was sich in den letzten 20, 25 Jahren politisch, sozial und kulturell verändert hat. Dieses 13jährige Ichselbst lebte in einer völlig anderen Welt.
Die Vorstellungen, mit mir selbst damals und dem, der ich heute bin eine Konversation zu führen, die natürlich so nie stattgefunden hat, war und ist eine intensive und befremdliche zugleich.
Das Kind oder der Jugendliche Clemens, der quatscht drauf los, ist unbefangen, ein bisschen naiv. Und der hat eben nicht das, was ein Erwachsener hat. Das Kind als Vorbild findet sich ja in antiken Zitaten, Zitaten in der Bibel bis zu Einstein: Dass man von den Kindern lernen kann und wieder ein Stück weit wie die Kinder werden muss. Es ist fast so, dass ich diesen Clemens, diesen 13-Jährigen, beneide um seine Lebendigkeit und Leichtigkeit: nicht so viel nachdenken, die Dinge einfach rauslassen. Als erwachsener Mensch läuft man Gefahr, manchmal zu abwägend, zu nachdenklich, vielleicht sogar zu vorsichtig zu werden. Ich lerne gerne von dem 13-jährigen Clemens!
Wird es in Zukunft noch einen dritten Clemens geben?
CK: Das ist schon immer der gleiche Clemens, da sind nur ein paar Jährchen dazwischen. Das ist noch keine Identitätsdiffusion, ich sehe mich schon als einheitliche, ganze Person (lacht). Ein dritter Clemens wäre also nicht notwendigerweise ein anderer. Es wäre dann nur ein anderes Spiel mit mir selbst. Vielleicht mache ich mit dem Material, was ich jetzt mache, später in 20 Jahren mal wieder Arbeiten, die sich auf eine Zeit im Hier und Jetzt und die Zukunft, die dann die Gegenwart ist, beziehen.
Du bist bildender Künstler, aber auch ausgebildeter Psychoanalytiker. Wie funktionieren die beiden Pfade miteinander? Stand bei deiner Ausbildung vielleicht sogar von vornherein ein künstlerischer Ansatz mit drin?
CK: Die Ausbildung habe ich erst gemacht, als ich schon längst als Künstler aktiv war, und ausschließlich, um mein künstlerisches Instrumentarium zu erweitern.
Dieses Psychoanalytiker-Sein ist für mich ein wesentlicher Bestandteil meiner künstlerischen Arbeit, meines künstlerischen Denkens und Handelns. Für mich sind psychoanalytische Techniken, die Theorie und auch die Erfahrung mit so vielen Biografien ein ganz wesentlicher Bestandteil meiner Arbeit geworden. Das unterscheidet mich von anderen Künstlerinnen und Künstlern: Das ich wirklich diese professionelle Richtung in der Psychoanalyse habe und das auch in interventionellen Projekten in diesen Kunstkontext reinbringe.
Psychoanalyse und Kunst verbinden zwei ganz wesentliche Punkte: Einerseits haben sie das Potential, den Menschen über das kritische Denken hinaus zu affizieren, andererseits üben sie wesentliche soziale und politische Funktionen aus. Ohne zu moralisieren.
Die Vielschichtigkeit deiner Arbeiten soll dazu einladen, einzelne Überlagerungen zu hinterfragen, Schichten immer wieder in ein neues Licht zu rücken. Hat die jetzige Coronazeit etwas am Erzählstrang deiner älteren Arbeiten verändert?
CK: Ich kann dazu eine lustige Anekdote erzählen: Ich hatte im Juni 2020 eine Ausstellung in Sydney, Australien. Dort wurde die Serie 2017-2021 gezeigt, eine Art tagebuchartige Visualisierung meiner Wahrnehmung von sozialen, politischen und kulturellen Prozessen meiner Umgebung. Die Serie begann 2017 und soll bis 2021 fortgeführt werden. Eine dieser Arbeiten hieß World Corona. Sie stammt aber vom August 2019, nachweislich – da sie damals auch fotografiert wurde. Der Galerist hat zu mir gesagt: ‚Clemens, die Arbeit kann doch nicht so heißen. Glaubt ja jeder, Dir fällt nichts Besseres ein.‘
Das Bild stellt ein menschliches Herz dar, das auf einem Teller liegt. Man sieht deutlich die Coronararterien, also die Herzkranzgefäße. Corona heißt ja Kranz oder Krone und bezieht sich in Zusammenhang mit dem Virus nur auf dessen äußere Form. Ich habe die Arbeit dann im Nachhinein unbenannt. Das Bild heißt zwar immer noch Corona aber jetzt mit dem Zusatz _August 2019. Der Monat im letzten Jahr, in dem noch 99% der Menschen das Wort nicht kannte, allenfalls als Markenname eines Getränks.
Sehr deutlich wird die Brücke von der Psychoanalyse zur Kunst in „Isolation Consultation“. Hier hast du psychoanalytische Einzelsitzungen durchgeführt, in Coronazeiten beschränkte sich das auf die virtuelle Zusammenkunft und hatte einen starken Fokus auf diese verrückte Zeit. Warst du hier der Betrachtende oder der Betrachtete?
CK: Selbstverständlich beides. Das Kunstprojekt Isolation Consultation, das vom Berliner Haus am Waldsee initiiert wurde und dann von anderen Museen, Galerien und Künstlern geteilt wurde, hat Teilnehmende aus der ganzen Welt zu mir geführt. Während des sogenannten Lockdowns, der Isolation, führte ich online über 300 analytische Einzelgespräche mit Menschen aus Australien, Europa, Amerika. Das ging von Ende März bis Mitte Mai. Zunächst einmal war ich der Künstler, der das Projekt initiiert hat. Und alle Teilnehmende waren wie Besucher und Besucherinnen einer Ausstellung. Die Verschiebung der Rollen zum Analytiker und Patienten bzw. des therapeutischen Kontexts in den künstlerischen, waren die zentralen performativen Elemente. Und dass es keine Möglichkeit gab, von „außen“ zuzusehen.
Mir ging es nicht um ein reines Verschieben eines analogen Inhaltes in den digitalen Raum, sondern darum, dass etwas Neues entstanden ist. Diese virtuelle Zusammenkunft. Da wurde ein abstrakter Raum geschaffen, welcher nur von den Teilnehmenden und mir gestaltet wurde. Eben auch wieder dieses ‚Dritte‘. Das heißt, da gibt es als Akteurinnen die Teilnehmenden und mich und dann das, was dabei entsteht.
Die Inhalte waren teilweise sehr heftig. Du sprichst ja auch von einer verrückten Zeit. Es gab mitunter krasse Momente, auch wiederum mit Menschen aus der ganzen Welt mit verschiedensten sozialen und kulturellen Hintergründen. Wenngleich sich in diesen analytischen Einzelsitzungen auch eine große Metaebene abbildete, die die Gespräche miteinander verbunden haben.
Die Performance ging an meine körperlichen und psychischen Grenzen. Mit dieser eigenen Ausgeliefertheit bin ich den vielen Teilnehmenden in ihrem Ausgeliefertsein in der Isolation begegnet. So gesehen war ich nicht nur Betrachter und Behandler, sondern auch Betrachteter und Behandelter.
Interview: Olga Potschernina
Photos: K. Laschkow/courtesy Galerie CRONE Berlin/Wien