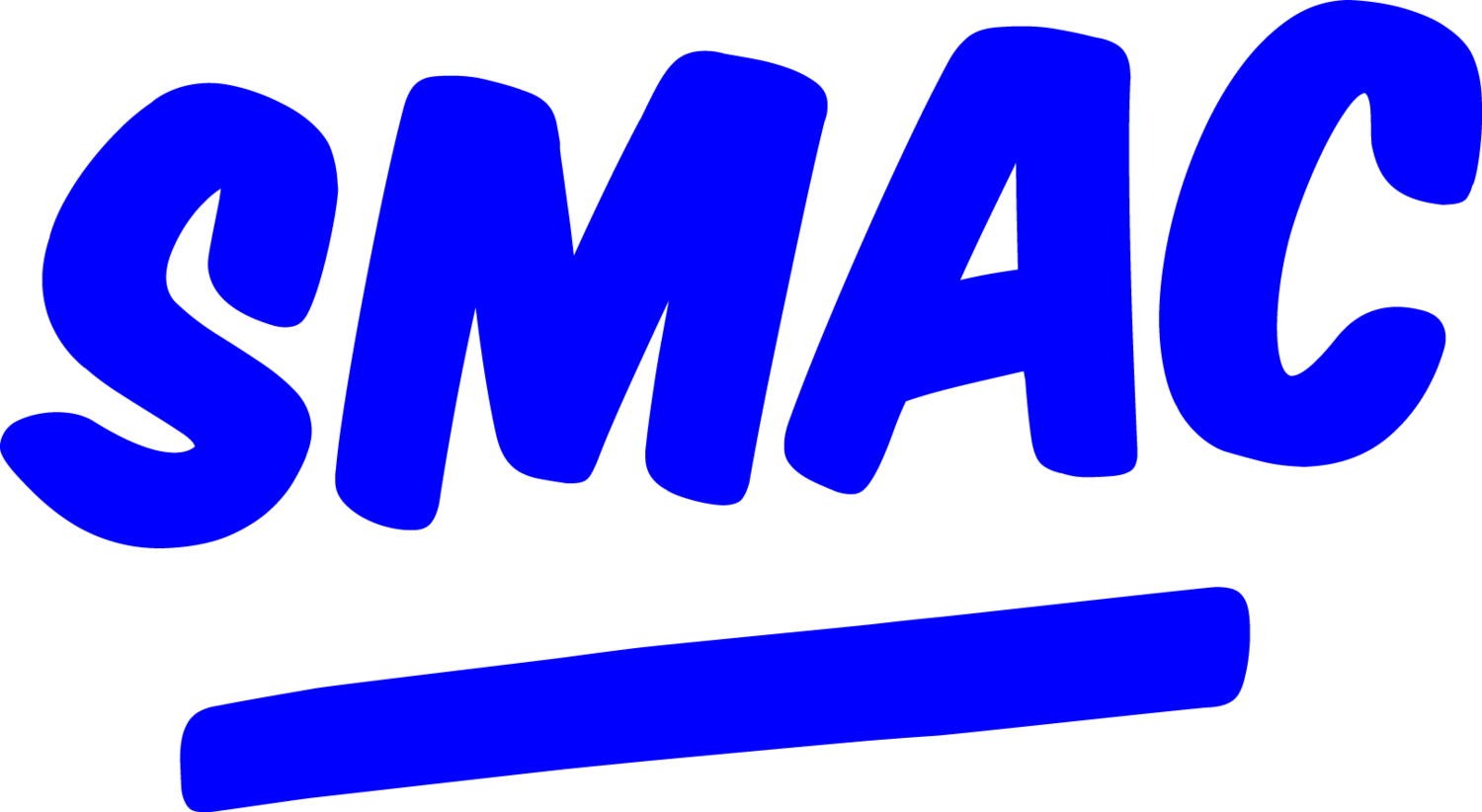Interview mit Christian August
Christian August, auch bekannt unter dem Namen Kid Cash, stellt in seiner SMAC-Ausstellung die Erfahrung von großformatigen, abstrakten Bildwelten in den Vordergrund.
Nach seinen Anfängen in der Graffiti Szene Mitte der Neunziger zusammen mit der Künstlergruppe KLUB7, malt er zunehmend auf Leinwänden und stellt in Galerien aus. Inspirationsquelle sind für ihn die kleinen Momente und Zufälligkeiten im urbanen Alltag, aber auch Künstler wie Hans Arp und Henri Matisse, die durch ihre Auseinandersetzung mit Formen und Flächen ein neues Verständnis von abstrakter Kunst geschaffen haben.
Seine Kunst zeichnet sich mehrheitlich durch große Formate aus, denn diese sind es, die ihm Spontanität und Schnelligkeit in seiner Malweise ermöglichen, so wie er es von den Mauern der Stadt gewöhnt ist.
SMAC: Graffiti und Street Art haben in den letzten Jahren immer mehr an Popularität gewonnen, seit dem letztem Jahr gibt es sogar ein Street-Art-Museum in Berlin. Auch Du hast in der Graffiti-Szene angefangen. Woher rührt deiner Meinung nach das zunehmende Interesse für dieses Thema?
Christian August: Ich denke es hängt zum einen damit zusammen, dass die Szene älter wird. Die Graffiti-Maler der 70er Jahre in New York haben mittlerweile Enkelkinder. Das Interesse trägt sich natürlich in eine Gesellschaft rein. Ich selber bin jetzt 40 und habe vor 25 Jahren angefangen mit Graffiti. Ich glaube, dass das Verständnis dafür mit wächst. Die Kinder werden aufgeklärt und auch die Eltern sind vorurteilsfreier oder malen selber. Außerdem würde ich sagen, dass sich durch die Entwicklung vom Graffiti, über Street Art bis zur Urban Art ̶ alles was im urbanen Raum an Aktivitäten passiert, an Malereien, an Kommunikationen ̶ natürlich auch das Verständnis dafür gebessert oder aufgelockert hat. Es gibt nicht nur die Anti-Haltung der Gesellschaft, sondern viele Meinungen dazwischen, es gibt nicht nur das „häßliche Gekrakel“ und das „bunte, schöne Graffiti.
Dazu kommt, dass sich viele Künstler aus meiner Szene weiterentwickelt haben und in den letzten Jahren verstärkt auf Leinwand gemalt haben. Und wir hinterfragen die Leinwand nicht als Medium. Das heißt wir wechseln direkt von außen, von der Wand, nach innen, zur Leinwand und machen unsere Arbeit transportabel und versuchen uns mit dem Innenraum zu arrangieren. Was ich jedoch gemerkt habe, ist, dass sich die Leinwand-Arbeiten vieler Künstler von ihren Arbeiten auf der Wand unterscheiden, weil das ein komplett anders zu verstehendes Medium ist.
“Es geht mir nicht mehr um Lesbarkeit. Heute geht es mir um Verfremdung.”
Wann wurde dein Interesse an einem portablem Medium bzw. einer anderen Art von Kunst geweckt?
Das war ein schleichender Prozess. Schon während ich damals mit Grafitti begann, versuchte ich parallel auch Leinwände. Aber das war für mich lange Zeit kein vordergründiges Medium. Das Arbeiten auf der Wand war mit lange Zeit wichtiger und ich probierte wahnsinnig viel aus, malte bis heute über tausende Wände in städtischen Räumen.
Erst in den letzten Jahren wurde die Leinwand immer wichtiger für mich, weil ich auch in Galerien ausstellen wollte, um wiederum andere Leute mit meinen Arbeiten zu erreichen.
Gibt es bestimmte Buchstaben, die besonders für dich sind?
Ab und zu ja. Ich habe mir über die Jahre ein eigenes Formverständnis für Buchstaben erarbeitet.
Formen die ich benutze stammen von Buchstaben ab, aber beim Malen denke ich nicht mehr zwingend daran. Heute denke ich oft nur an die Formensprache und was ich damit ausdrücken kann. Es geht mir nicht mehr um Lesbarkeit. Heute geht es mir um Verfremdung.
Mittlerweile malst du zunehmend auf Leinwänden und stellst deine Werke in Galerien aus. Was macht es deiner Meinung nach mit deiner Kunst, wenn sich der Ort des Geschehens von der Straße in die Galerie verlagert?
Das ist auf jeden Fall erstmal ein Konflikt an sich, weil man den Künstler vor Augen hat und seine Arbeiten, die er im urbanen Raum geschaffen hat. Und dann gibt es plötzlich die Situation, dass er in den Raum geht und das Medium dazu noch transportabel macht, z.B. auf Leinwand. Das sind alles Sachen, die nichts mehr mit dem Ursprung der Graffiti zu tun haben, nicht mehr in Kommunikation treten mit den Leuten und mit anderen Künstlern im öffentlichen Raum. Sondern das Bild befindet sich plötzlich im White Cube, im Museum, unantastbar. Im öffentlichen Raum ist alles vergänglich.
Ich überlasse der Stadt mein Werk und es kann am nächsten Tag schon etwas damit passiert sein. In der Galerie weiß ich, dass ich die Leinwand am Ende wieder unversehrt abnehmen kann. Das macht natürlich was mit mir und mit meiner Arbeitsweise. Ich weiß, dass ich auf Leinwand viel bewusster male oder anders gesagt ̶ wenig intuitiver. Die Straße bzw. der urbane Raum mit all seinen Gegebenheiten fordert mich ganz anders heraus. Wenn ich Graffiti malen will, dann muss ich schnell sein, dann kann ich nicht tausend Farben benutzen, sondern nur wenige. Ich muss nachts malen und sehe kaum etwas. Wenn ich im Atelier bin, Musik höre, mir einen Kaffee mache und vor einer Leinwand stehe, die strahlend weiß ist, dann hab ich fast Ehrfurcht davor. Die muss ich dann erstmal beseitigen, um gut malen zu können.
Was auch ein entscheidender Punkt ist: Die Leinwand ist weich. Sie ist für mich ein zartes Medium, mit einer feinen Struktur. Eine Wand dagegen ist hart, grob, rau. Sie bringt viele Strukturen mit sich und erfordert damit eine ganz andere Malweise. Daher unterscheiden sich meiner Meinung nach auch meine Bildinhalte von der Mauer zur Leinwand.
“Ich habe jahrelang auf überlebensgroße Wände gemalt und bin es daher gewohnt mit ganzem Körpereinsatz zu malen.”
Was können wir bei der SMAC-Ausstellung erwarten?
Ich habe eine neue Serie unter dem Namen RECOVERY gemalt. Diese bezieht sich auf Arbeiten, die ich im letzten Jahr gemalt habe. Da gab es eine Serie, die innerhalb eines Stipendiums entstanden ist und es eine große Einzelausstellung unter dem Namen VERY NECESSARY. Bei diesen beiden Ausstellungen habe ich viel ausprobiert. In der SMAC-Ausstellung konzentriere ich mich auf Konsequenz und Reduktion. Trotzdem ist mir eine gewisse Komplexität in meinen Bildern wichtig. Komplexität ist für mich in vielerlei Hinsicht nicht begreifbar. Aber sie inspiriert mich genau deshalb. Sie macht mich klein.
Der Titel RECOVERY bezieht sich dazu auf die Geburt meiner Tochter in diesem Jahr. Da hat sich für mich einiges geändert, weil ich nicht mehr nur für mich als Künstler stehe. Ich bin jetzt Vater und ich trage vor allem Verantwortung für meine Familie.
Das hat sich auch auf meine Arbeiten ausgewirkt. Ich hab viel klarer vor Augen, was ich will. Und auch beim Malen bin ich viel konsequenter geworden.
Man könnte die RECOVERY Bilder als seriell beschreiben. Es ist mir schon wichtig, dass alles ineinander fließt. Die Arbeiten beziehen sich aufeinander, ergänzen sich, sprechen miteinander.
Es fällt auf, dass die meisten Leinwände von dir sehr großflächig angelegt sind. Welche Rolle spielen Format und Größe deiner Werke bei der Wirkung auf den Betrachter?
Ich würde sagen, es spielt eine nicht unwesentliche Rolle. Ich habe jahrelang auf überlebensgroße Wände gemalt und bin es daher gewohnt mit ganzem Körpereinsatz zu malen. Das Gefühl brauche ich auch, wenn ich auf Leinwand male. Deshalb fällt es mir schwerer auf kleinen Formaten zu arbeiten. Leinwandgrößen, die über meine Körpergröße hinausgehen, sind meine Lieblingsformate. Da habe ich viel Körperbewegung in meiner Malerei, fast schon sportlich manchmal.
“Nach der Wende war plötzlich alles offen. Viele wussten nicht, was genau sie machen konnten und sollten. Dieses Gefühl hat mich vielleicht zur Hip-Hop-Kultur gebracht.”
Dein Künstlername Kid Cash verweist zum einen auf die New Yorker Graffiti-Szene der 70er Jahre aber auch auf die Subkulturen der Nachwendezeit. Was genau hat dich aus dieser Zeit geprägt?
Zur Wende war ich 12 Jahre alt und ich fand die neue Produktwelt interessant, die sich mir durch den Markt des Westens eröffnete ̶ Coca Cola, Milka und Kinder-Überraschung. Als ich Anfang der Neunziger jugendlicher wurde, spürte ich eine größere Orientierungslosigkeit überall. In der DDR waren viele Lebenswege und Karieren mehr oder weniger durch den Staat und die Gesellschaft geregelt. Die Möglichkeiten waren von Anfang an klarer definiert.
Nach der Wende war plötzlich alles offen. Viele wussten nicht, was genau sie machen konnten und sollten. Dieses Gefühl hat mich vielleicht zur Hip-Hop-Kultur gebracht. Das haben wir damals so schön gesagt. Heute klingt das fast kitschig. Aber das gab es halt in den 90ern, das habe ich so gelebt, und das kam ja aus Amerika und ich habe durch Filme, wie Beatstreet und Wildstyle, das Lebensgefühl aufgenommen und habe mich innerhalb dieser Szene wiedergefunden, die mich aufgefangen hat. In dieser Szene konnte ich mich auch entwickeln, wurde als jemand angesehen, weil ich Graffiti gemalt habe und dieses Gefühl hat mich schon stark geprägt. Auch, dass die Szene von einem Großteil der Gesellschaft abgelehnt wurde. Das war meine Art von Rebellion als Jugendlicher.
Letztendlich habe ich darüber meine Freunde kennengelernt, mit der ich heute als Künstlergruppe KLUB7 zusammen arbeite und wir haben gerade unser 20-jähriges Bestehen gefeiert.
“Matisse, mit seinen Scherenschnitten und reduziert abstrahierten Figuren, hat für mich starke Parallelen zudem, was heute in der Graffiti- und Street-Art-Szene passiert.”
Wie siehst du die Entwicklung der Gruppe jetzt, 20 Jahre später?
Die Entwicklung ist sehr spannend, bis heute, denn es gab immer wieder große Schritte. KLUB7 ist eine Künstlergruppe die wir 1998 gegründet haben. Es ist ein Zusammenschluss von sechs Künstlern — Dani Daphne, Mike Okay, Diskorobot, Otto Baum, Lowskii und mir. Seit vielen Jahren starten wir von Berlin aus internationale Projekte und Ausstellungen. Wir malen auf Wände, Fassaden, in Räumen und auf Leinwänden. Künstlerisch aktiv waren wir in den letzten Jahren unter anderem in New York, Tel Aviv, Paris, Kopenhagen und Amsterdam.
Im Mittelpunkt unseres Schaffens als Gruppe steht der gemeinsame Prozess des Malens. Dieser ist uns oft viel wichtiger als das Ergebnis. Es macht dazu einfach Spaß mit Freunden zu malen und aufeinander einzugehen, vor allem auf Wänden, Fassaden und in Räumen. Außerdem können wir als Gruppe mittlerweile wirklich riesige Projekte realisieren.
Aus der anfänglichen Graffiti-Crew ist die Künstlergruppe KLUB7 geworden, für mich, neben meiner Familie, eines der wichtigsten Sachen in meinem Leben ist!
Die starke Auseinandersetzung mit Formen, Flächen und Farben in deinem Werk weckt Assoziationen an Stilrichtungen wie den Kubismus und Fauvismus. Wie würdest du generell den Einfluss von Malern der Klassischen Moderne auf deine Kunst beschreiben?
Den Einfluss gibt es auf jeden Fall. Ich habe ja kein klassisches Kunststudium hinter mir, sondern Design studiert, weil mich das nach dieser ganzen Graffiti-Entwicklung der Neunziger am meisten interessiert hat. Ich hatte das Gefühl, ich will was neu gestalten und Designer werden. Und während des Studiums habe ich gemerkt, dass mich Design einschränkt. Mit dem Umzug nach Berlin hat sich mein Lebensinhalt immer mehr zur Kunstwelt gewendet. Ich habe viele Ausstellungen über die klassische Moderne besucht, viele Museen. Ich habe mich vor allem für Picasso und Matisse interessiert und für viele Surrealisten, wie Breton, Buñuel, Dalí, Man Ray, Yves Tanguy und Max Ernst. Matisse, mit seinen Scherenschnitten und reduziert abstrahierten Figuren, hat für mich starke Parallelen zudem, was heute in der Graffiti- und Street-Art-Szene passiert. Bei Picasso hat mich immer seine Bandbreite, seine Unruhe, nicht stehen zu bleiben, immer was Neues zu suchen, immer mehr zu abstrahieren, inspiriert. Später hat mich auch Hans Arp durch seine Formen und Kompositionen beeinflusst, wo ich Parallelen zu meiner Art der Abstraktion von Buchstaben gesehen hab.
Was fasziniert dich am Thema Abstraktion, warum malst du abstrakt?
Ich wollte oft das verwerfen, was anerkannt war, was funktionierte, was sichtbar war, was mir zu eindeutig erschien. Wenn ich heute male, dann habe ich das Bedürfnis mit meiner Malerei eine neue Welt zu eröffnen, die ich noch nicht kenne, die außergewöhnlich ist, die es nur in meiner Malerei gibt. Ich möchte meine Gefühle und Denkweisen damit sichtbar machen. Das kann ich am besten in der Abstraktion ausleben.
Letzte Frage: Du hast einmal gesagt, dass du deine Inspiration häufig im Alltäglichen findest. Gab es spezielle Alltags-Momente oder Situationen die dich bei deinen neuesten Werken inspiriert haben?
Ja, das inspiriert mich immer wieder. Ich gehe mit sehr wachen Augen durch die Stadt und mir fallen viele Orte auf, die für die meisten Menschen, unbedeutend sind. Ich sehe dazu viele Stellen, die ich gern bemalen würde.
Ich mag Situationen, die aus der Norm herausfallen, die zufällig entstanden sind und plötzlich etwas witziges aufmachen, irgendwelche Fehler, etwas das nicht so richtig passt. Ich mag es, wenn Sachen zufällig entstanden sind, ohne dass sich dabei jemand etwas gedacht hat.
Mich faszinieren auch Baustellen mit ihrem ganzen Material, wie es arrangiert ist, wie es rumliegt, zusammenspielt.
Und diese Zufälligkeiten versuche ich in meine Malerei einfließen zu lassen. Ich habe mir Techniken erarbeitet, die solche Zufälligkeiten zulassen. Ich mag es wenn ich beim Malen in eine Welt eintauchen kann, in der ich loslassen kann.
Interview: Anna Ker
Transcription: Lisa Staub
Photos: Luke Johnson