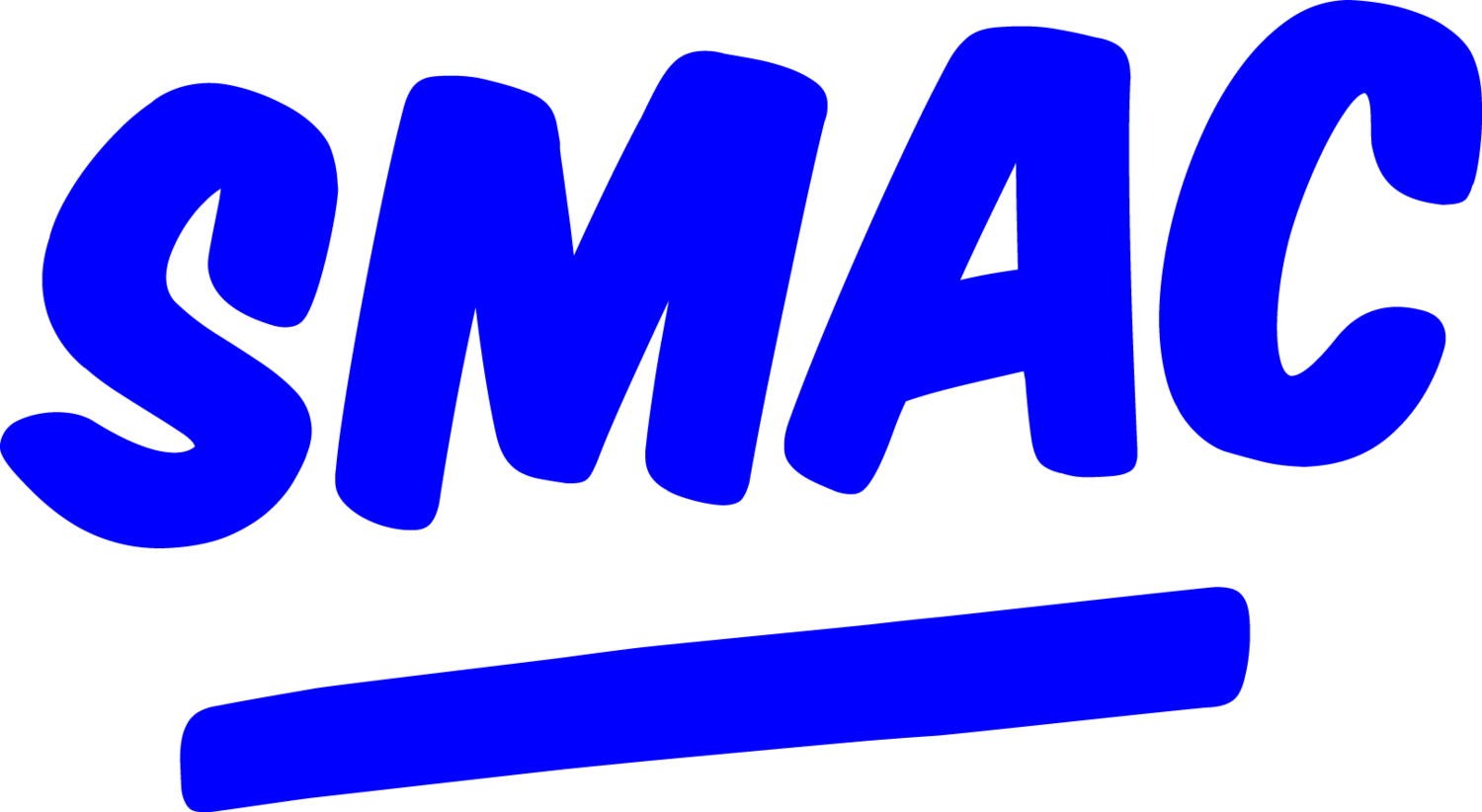Interview mit Charlie Stein
UNIMATE // 17. September – 2. Oktober 2021
Charlie Stein malt fast ausschließlich Frauen. Die Augen ihrer Modelle sind übergroß, ihre Züge beinahe kindlich, ihre Kameraposen von urbaner Subkultur geprägt – und von den visuellen Trendspiralen sozialer Medien. Umgeben von Accessoires in Zuckerwattefarben hocken oder liegen einige von ihnen nicht zufällig in quadratischen Bildausschnitten: In ihrer Haltung stauchen sie sich auf das vor allem für Instagram typische Format zusammen, um sich in Ganzkörperaufnahmen größtmöglich präsentieren zu können.
Aber die Künstlerin (*1986) arbeitet sich nicht nur an den Bilderfluten digitaler Räume ab, die Schönheitsideale durch Filtermöglichkeiten und neue Regeln für die Bildinszenierung verschieben. Titel wie Van Eck Phreaking oder Hangout Beta verraten, dass es sich bei den Modellen in ihren Bildernnicht um Menschen handelt: Künstlichen Intelligenzen wie Industrierobotern, Software, Betriebssystemen und Entwicklungstechnologien gibt sie nicht nur Gesicht und weibliche Form, sondern auch eine eigene Geschichte.
So werden bei Charlie Stein beispielsweise zwei konkurrierenden Spracherkennungsskripte – Apples Siri und Amazons Alexa – auf dem Schulhof zu Kindheitsfreundinnen. Ihr Werdegang gibt Aufschluss über die vielschichtigen Narrative der Arbeiten: Direkt im Anschluss an ihr Malereistudium an der Akademie der Bildenden Künste in München bei Gerhard Merz studierte Stein in Stuttgart bei Christian Jankowski und Rainer Ganahl. Spielerisch, mit schwarzem Humor und erst auf den zweiten Blick erkennbar setzt sie in ihrer Einzelausstellung Unimate im SMAC eine Verbindung zwischen der Historie von Servicetechnologien und dem Hang des Menschen zur Sklaverei. Über die Geschichte des Internets, digitale Ästhetik im analogen Raum und Malerei-Zeitreisen sprachen wir vor unserer Ausstellung bei einem Termin in ihrem Studio.
SMAC: Wir sitzen in der Sofaecke deines Studios. Es ist ausgesprochen gemütlich und aufgeräumt hier. Ist es für dich
als Künstlerin wichtig, deinen Arbeitsort für die Presse oder Sammler:innen zu öffnen, um präsent zu sein?
Charlie Stein: Zu Beginn war es für mich komisch, dass jemand sehen wollte, wie ich arbeite. Damit es im Studio diese Intimität geben kann, muss ich mich selbst wohlfühlen. Kunst zu machen, darüber zu sprechen und die eigene Arbeit zu präsentieren ist nach wie vor etwas im höchsten Maße Intimes für mich – intimer als nackt vor jemandem zu stehen. Ich setze ein Statement in die Welt, das ansonsten nicht da wäre. Es verlangt sehr viel Kraft, die eigene Arbeit so wichtig zu nehmen, dass sie andere Menschen sehen müssen. An sich ist es fast eine Anmaßung und es braucht einen Ort, um das abzufangen – einen Ort, der etwas Persönliches widerspiegelt. Außerdem glaube ich, dass die jeweilige Umgebung eine Ausstrahlung auf die eigene Arbeitsweise hat – Unordnung wertet ab. Ich möchte aber meiner Arbeit den Raum und Respekt geben, den sie verdient. Das ist ein bisschen so wie mit den eigenen Kindern: Ich möchte meinen Bildern die bestmöglichen Lebensumstände bieten.
Wenn deine Bilder sind wie deine Kinder, fällt es dir dann manchmal schwer, sie gehen zu lassen?
CS: Ja und nein. Ich glaube, dass ich in gewisser Weise auch pragmatisch bin. Ich weiß, dass nicht alles für immer bei mir bleiben kann. Aber manchmal hätte ich gerne etwas mehr Zeit mit einer bestimmten Arbeit oder ich würde sie gerne wiedersehen. Aber natürlich ist das Jammern auf hohem Niveau. Es ist schön, wenn meinen Arbeiten ermöglicht wird, gesehen zu werden.
Fällt es dir schwer, diese Arbeiten aufzugeben, weil sie dich gerade noch inspirieren oder sie Teil einer Phase sind, die du noch weiter bearbeiten möchtest?
CS: Als Malerin versuche ich immer, gewisse Problemlagen um mich herum zu identifizieren und in meinen Bildern zu bearbeiten – ein Prozess, der oft unbewusst abläuft. Jeden Tag prasselt eine Flut an Bildern auf uns ein, die wir verarbeiten, filtern und sortieren. Also sitzt man an einem bestimmten Thema und hangelt sich von einem Bild zum nächsten. Wenn dann eines von ihnen schon vor dem Abschluss dieser Phase fehlt, ist das schwierig. Andererseits verhält es sich damit wie mit Erinnerungen: Wenn man etwas Schönes erlebt, möchte man es für immer festhalten. Und trotzdem vergisst man vieles. Die eigene Persönlichkeit ist ständig im Flux und verändert sich pausenlos. Die Idee von etwas Statischem, dem wir lediglich neue Erinnerungen hinzufügen, ist falsch. Es kommen ja ständig weitere Dinge hinzu. Das ist der Prozess, wenn man durchs Leben wandert. Man erspart sich viel künstliche Aufregung wenn man den Gedanken aufgibt, alles kontrollieren zu können. Außerdem arbeite ich mit tollen Kurator:innen zusammen, die eine Expertise dafür haben, wo Arbeiten gesehen werden können. Als Künstlerin bin ich nicht die einzige Instanz und muss die Expertise anderer annehmen können.
Es gibt heute auch viel mehr Möglichkeiten, im Dialog mit Kurator:innen zu arbeiten. Gefühlt gibt es aktuell unheimlich viele junge Malerinnen. Ist da etwas im Umbruch?
CS: Wir sehen zur Zeit extrem viele extrem gute Malerinnen, wie beispielsweise Avery Singer oder Emily Mae Smith. Besonders in Deutschland ist das interessant: Es ist unheimlich naiv und heroisch von unserer Generation, zu sagen, wir wollen in Deutschland Malerinnen sein – nachdem alle vor uns aktiv totgeschwiegen worden sind. Es gibt die deutsche Bildhauerin, die deutsche Konzeptkünstlerin, vielleicht auch die deutsche Zeichnerin – ich denke dabei unter anderem an Hanne Darboven. Aber es ist unmöglich, zu behaupten, dass es die deutsche Malerin als Archetypus gibt, es scheint als wäre sie nie da gewesen. Ich arbeite viel mit Ironie, mit schrillen Farben und verfolge nicht komplett eine analytische, typisch deutsche Struktur – das ist auf jeden Fall ein Umbruch und etwas, das für Reibungen sorgt. 2017 habe ich eine Ausstellung mit einer Reihe von Selbstportraits gemacht, die sich mit Verzerrungen beschäftigte. Teilweise hatten die Bilder vergrößerte Augen, vergrößerte Münder und eine ungerade Anzahl von Ohren. An sich kein Grund zur Aufregung, aber die Arbeiten wurden zu meiner eigenen Irritation als sehr schockierend empfunden – das war spannend. Es gibt immer einen inneren Widerspruch zwischen dem Wunsch, Elitismus zu überwinden und viele Menschen zu erreichen, und dem, dass die eigene Arbeit nicht zu einem Schlafmittel für die Massen wird. Wenn sich mehr Kunstverständnis entwickelt, werden Sachen auch mit weniger Schock rezipiert.
In deinen Bildern gibt es viele Referenzen an die Funktionsweise und Ästhetik von Social Media, speziell Instagram. Wie beeinflusst dich die tägliche Bilderflut?
CS: Ich bin besessen von Technologie und Kommunikation. Unsere Generation hat das Aufkommen des Internets mit der eigenen Identität verknüpft wie keine andere Generation zuvor. Nicht die Generation unserer Eltern und nicht die Generation nach uns. Meine Technologiekompetenz hat sich mit dem Alter weiterentwickelt. Im Grunde sind Computer ein Homunkulus, der die Welt abbildet. Ich habe mit acht oder neun Jahren angefangen, die ersten MS-DOS Computer zu nutzen – zu diesem Zeitpunkt war das altersgerecht. Es gab nur den Cursor, um vor oder zurück zu springen, und die Leertaste. Mit der eigenen Entwicklung ist die Technologie ebenfalls herangewachsen. Als ich zwölf war, gab es die ersten Mails und mit ihnen plötzlich die Möglichkeit, Kontakt mit Menschen auf der ganzen Welt aufzunehmen. Technologie ist eine wahnsinnige Antriebskraft hinter der Bildauswahl, die ich treffe und ständig neu verhandle. Wenn ich beispielsweise ein Feuerzeug male, dann als Zelebration eines Apparatus, der eine der größten Errungenschaften in unserer Technologiegeschichte verkörpert: die Herrschaft über das Feuer. Heute kann jede:r das Feuer einfach in der Hosentasche herumtragen – so etwas fasziniert mich.
“Es geht immer um eine ideale Form, vor allem von Weiblichkeit oder vielmehr um eine komplett veraltete Form von Weiblichkeit. Damit spiele ich. Viele meiner Bildtitel verweisen auf historische Robotertechnologien – Modelle aus Fabriken, die es wirklich gegeben hat. ”
Wie verändert der allgegenwärtige Medienkonsum unser Kunstverständnis?
CS: Ich möchte genau da hinsehen, wo sich unsere Sehgewohnheiten verändern. Im Schnitt schauen wir um die 100 Mal am Tag auf unser Smartphone und sind in dieser Zeit der Bilderflut ausgesetzt. Enhanced images, also solche mit Filter, wirken sich auf die eigene Lebensrealität aus. Teilweise gehen Menschen heute mit “Filterfotos” in die Schönheitschirurgie, um ihr Aussehen dahingehend anpassen zu lassen. Vielleicht gibt das einzelnen Personen Freiheit, es sagt aber auch viel über die Restriktionen aus, mit denen vor allem Weiblichkeit immer noch belegt ist. Für viele Frauen spielt das Zur-Schau-Stellen der eigenen Schönheit nach wie vor eine große Rolle, was nichts anderes als eine Form der Standardisierung ist. Filter standardisieren und machen alle, die sie nutzen, zu virtuellen Geschwistern. Es geht immer um eine ideale Form, vor allem von Weiblichkeit oder vielmehr um eine komplett veraltete Form von Weiblichkeit. Damit spiele ich. Viele meiner Bildtitel verweisen auf historische Robotertechnologien – Modelle aus Fabriken, die es wirklich gegeben hat. Viele von ihnen sind mit bestimmten Attributen versehen: Der Pflegeroboter Grace trägt nicht ohne Grund einen weiblichen Vornamen, kann aber bis zu 200 Kilogramm schwere Patient:innen tragen. Im Grunde ist Grace ein Übermensch, die mit einer immensen Stärke konzipiert wurde, gleichzeitig aber gesellschaftlich als weiblich konnotierte Attribute trägt: helfen, pflegen, sich kümmern. Für diese Wesen schaffe ich Szenarien, wie für Siri und Alexa, die auf einem Bild zusammen draußen auf dem Schulhof sitzen. Die Vorstellung, dass diese beiden Spracherkennungsskripte in ihre eigenen Metaversen entlassen werden, aber auch der Wunsch des Menschen, Sklaven zu produzieren – und die Frage, woher dieser letztendlich kommt – tauchen immer wieder in meinen Arbeiten auf.
Es sind weibliche Sklaven. Besteht da ein Zusammenhang zu patriarchalen Strukturen?
CS: Die Strukturen, die über die letzten vielleicht 10.000 Jahre gewachsen und von gesellschaftlichen Umbrüchen geprägt worden sind, kann man nicht von heute auf morgen ändern. Und es ist schwer, Menschen, die vielleicht eine Mutter, Schwester oder Tochter haben, die aber selbst nicht betroffen sind, zu erklären, dass selbst bei gleicher Leistung das Ergebnis nicht das gleiche ist. Es ist wahnsinnig schwierig, eine Künstlerin über 30 zu finden, die schlechte Arbeiten macht. Frauen, die sichtbar sind, müssen extrem gut sein. Es hält sich aber hartnäckig das Gerücht, dass Frauen nicht malen können. Wenn wir mit unseren kleinen Händen besser putzen können, dann können wir unter Garantie auch besser kleine Pinsel halten. Ich selber erlebe viel positives Feedback für meine Arbeiten und muss nicht ständig gegen Windmühlen kämpfen. Die Strukturen bestehen aber nach wie vor. Gerade in Kunsthochschulen braucht es viel mehr Professorinnen und weibliche Vorbilder.
Du wiederum hast bei drei Männern studiert, die sehr unterschiedlich arbeiten: Christian Jankowski, Rainer Ganahl und Gerhard Merz. Du selbst hast vor der Malerei auch Skultpuren und vor allem Videokunst gemacht. Ist das auf dein Studium zurückzuführen?
CS: Kunst ist für mich eine Art, die Welt um mich herum zu erfahren. Im Studium habe ich schnell gemerkt, dass für mich das klassische Lehrer:in-Schüler:in-Modell nicht gut funktioniert. Als Professor:in unterrichtest du in Deutschland die Kunst, die du selbst machst – ich wollte aber immer den Sachen nachgehen, die für mich interessant sind, und so meine eigene Identität entwickeln. Deshalb gab es mehrere Wechsel: Ich wollte mehr als lediglich eine Perspektive kennenlernen. Im Studium habe ich relativ wenig gemalt, obwohl ich wie so viele mit einem Malereiportfolio an die Kunsthochschule gekommen bin. Dort habe ich andere Möglichkeiten entdeckt, mich visuell auszudrücken. Eine zeitlang habe ich ziemlich erfolgreich Film gemacht – es ist schwierig, etwas aufzugeben, das funktioniert und dabei nicht auf Professor:innen zu hören. Es hat viel Selbstreflexion gefordert, um zu meinem eigenen, initialen Interesse zu finden. Ich sehe mich als Malerin und identifiziere mich vornehmlich mit dem Medium der Malerei, weil ich mich in ihr am besten ausdrücken kann.
“Da die Malerei diese langen Zyklen der Menschheitsgeschichte durchlebt hat, fühlen sich Maler:innen sehr oft mit ihren Vorgänger:innen stark verbunden. Malerei macht Zeitreisen möglich. ”
Die Malerei ist eine Kunstform, die sich über die Jahrhunderte kaum verändert hat. Wie passt das zu deinem Interesse an fortschreitenden Technologien?
CS: Unsere älteste und archaische Ausdrucksweise ist es, wie man in den Höhlenmalereien sehen kann, reale Abbilder in eine Zweidimensionalität zu werfen und so ein Zeichen zu hinterlassen. Da die Malerei diese langen Zyklen der Menschheitsgeschichte durchlebt hat, fühlen sich Maler:innen sehr oft mit ihren Vorgänger:innen stark verbunden. Malerei macht Zeitreisen möglich. Wenn man bestimmte Techniken beherrscht und sich im Louvre oder Prado die Bilder von beispielsweise Diego Velázquez ansieht, entsteht ein sehr kollegiales Moment: Das Wissen darum, dass er ziemlich weiche Pinsel verwendet haben muss und seine Bilder anscheinend sehr geduldig hat trocknen lassen, verbindet. Die Malerei wird immer wieder totgesagt, aber sie wird immer weiter fortbestehen. Weil es dieses Moment im Erzeugen des Bildes gibt, das zurückblickt – in welcher Form auch immer. Die Malerei ist tot, lang lebe die Malerei.
Deine Ausstellung bei Smac heißt Unimate. Was hat es damit auf sich?
CS: Eine Überlegung war die des Übermenschen, der vor allem in Frauen, aber auch anderen marginalisierten Gruppen immer wieder erwartet wird. Die großen Augen meiner Modelle sind nicht nur anziehend. Teilweise starren sie recht anklagend zurück. Darin liegt die Frage, welche Frauen oder Frauenbilder gesellschaftlich erwartet werden und wie wir uns über diese Erwartungen hinwegsetzen können. Meine Ausstellung wird nur Malereien zeigen, aber ich sehe sie auch als Installation. Es wird kleine SUVs geben, die umherfahren und Bilder transportieren. Sie heißt nach einem Roboter aus den frühen 1960er Jahren: Unimate war der erste Industrieroboter des US-Automobilherstellers Ford und wurde am Fließband eingesetzt, um zu montieren und zu schweißen – und bestand nur aus einem einzigen Arm. Die Vorstellung, dass sich aus diesem ersten Modell eines entwickelt, das Arme und Beine hat, und sich schließlich der Arbeit verweigert, fasziniert mich sehr. Der Prozess ist im Grunde ein Abbild der Kunst, die ebenfalls völlig ohne konkretes Ziel stattfindet. Ein Roboter, der sich wie Melvilles Bartleby, the Scrivener der Arbeit verweigert, ist fast schon eine Ermächtigung in die Kunst: Es ist eine Abgrenzung nach außen und eine Verneinung der Sklaverei. Ich zeige Roboter mit weiblichen Zügen – in der Verneinung ihrer eigentlichen Funktion liegt eine große Kraft.
Interview: Hanna Komornitzyk
Fotos: Stephanie Neumann